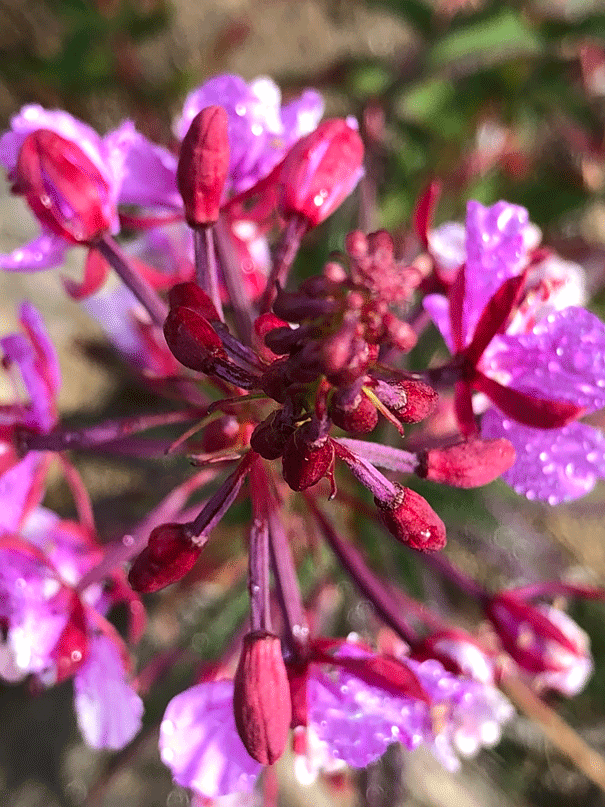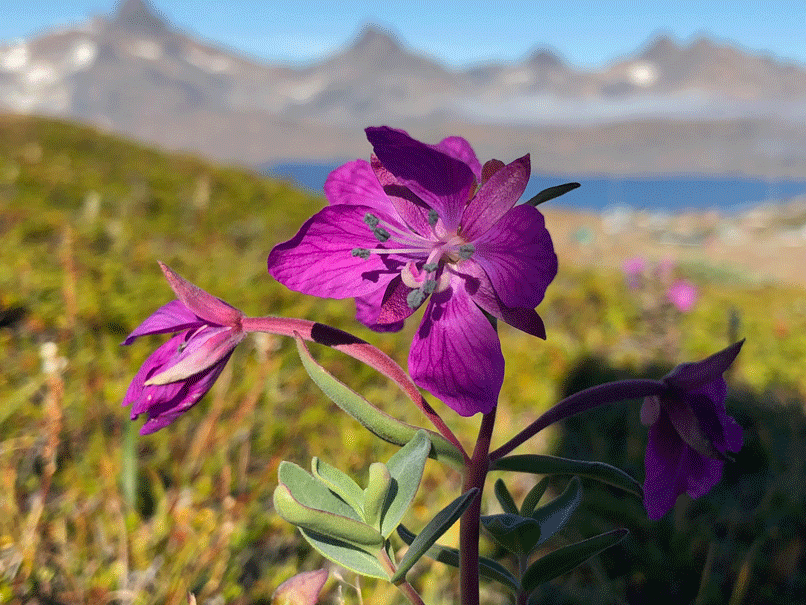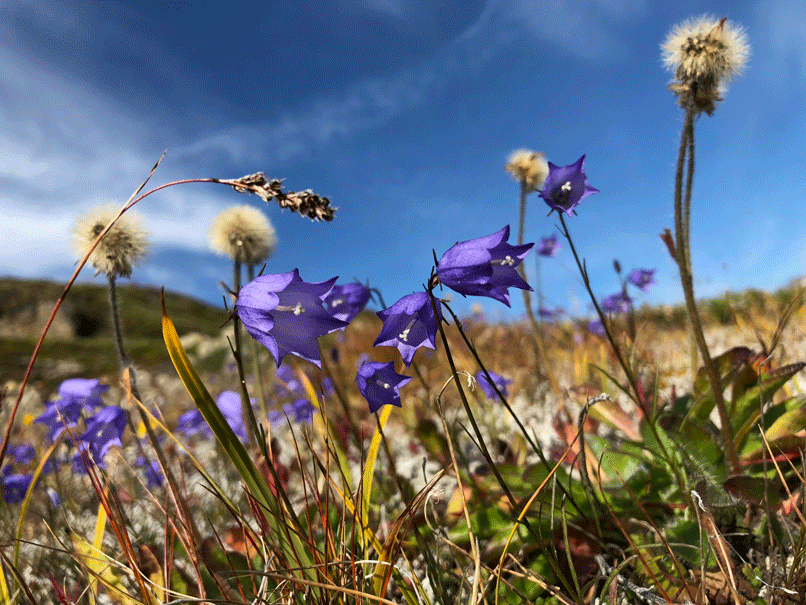Tag 7 - New Pelion Hut zur Kia Ora Hut
Laufzeit zwischen 4 und 6 Stunden
9 Kilometer
780 Meter Anstieg, 760 Meter Abstieg
















Es war so eine herrliche Nacht - allein in diesem Raum. Ganz mit mir. Aber trotz der Wände haben mich die nervösen Energien der eifrigen Gipfelstürmer erreicht. Im Schlaf übersetzt, formen sie sich in eigenartige, verstörende Träume, die mich herzklopfend zurücklassen und mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann. Sie gehören nicht zu mir. Die flirrende Hektik des Morgens, das Türenschlagen, das Reden - alles ist gedämpft, aber nicht unhörbar. Ich bleibe liegen, ich brauche Zeit, um wieder in mir anzukommen und es fällt mir nicht leicht.
Ich habe mich noch nicht entschieden, wohin meine Reise heute geht. Die Berge locken mich. Dieser wunderschöne Mt. Oakleigh, Mt. Ossa. Ja, ich hätte Lust auf den Gipfel, irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Etwas in mir hat sich komplett verändert. Dieses Gefühl, mir selbst etwas beweisen zu müssen, mit einer Bergbesteigung, ist vollkommen verschwunden. Ich habe keinerlei Lust mehr, einem rigiden Zeitlimit folgen zu müssen, nur um dort oben zu stehen. Ich habe keine Lust, für ein Ziel, einen Teil des Weges aus meiner bewußten und tiefen Wahrnehmung auszusperren. Und das müsste ich, wenn ich auf der heutigen Tagesetappe, auf dem Mt. Ossa stehen wollte. Denn dieser Seitentrip dauert allein mindestens 4-5 Stunden. Klettergelände und ca. 450 Meter Höhenunterschied oben drauf.
Wieviel Zeit zum Fühlen und Da-Sein würde mir dort oben wirklich bleiben? Wieviel vom Weg würde ich dabei noch erleben können? Meine Gedanken wandern zurück. Ich war schon dort. Ich habe die Bilder einer Schneelandschaft vor mir. Aber die Aussicht vom Gipfel selbst, ist vollkommen ausgelöscht. Ich weiß, ich stand da und konnte die Weite umarmen, aber die Sorge um den Abstieg, mögliche Wetterwechsel und den Schwierigkeitsgrad des Kletterns haben mir jeden tiefen Kontakt mit dem Ort versperrt. Ich war nur mit Auf- und Abstieg beschäftigt. Will ich das noch einmal erleben? Nein. Könnte ich es heute verändern? Ich glaube nicht.
Denn es kommt noch etwas dazu. Damals war ich allein. Damals war die Stille ganz präsent. Der tiefe Frieden der Berge, den ich so sehr liebe. Heute wären circa 20-30 Menschen gleichzeitig mit mir auf dem Berg. Mit dieser Energie, die ich in der Hütte nur zu gut spüren konnte und von der ich nichts mehr aufnehmen will. Der Energie des Wettbewerbes. Der Energie der Eroberung. Der Energie des "sich selbst beweisen müssens", um gut zu sein. Ich werde auch ohne Mt. Ossa, damit zu kämpfen haben, in diesem wilden Meer hochgepeitschter Emotionen, in meiner inneren Harmonie und Balance zu bleiben.
Ich spüre auch eine Art von Müdigkeit, mich selbst an ein körperliches Limit zu pushen. Ist es nicht anspruchsvoll genug, mit diesem prall gefüllten Rucksack über den Trail zu laufen? Meine Knie sagen eindeutig ja. Mein Herz auch. Ich folge Beiden. Aber vor allem folge ich meiner Seele und diesem stillen, tiefen Glück, jeden Meter des Weges mit allen Sinnen zu liebkosen.
Nach nur wenigen Metern, begegnet mir zum ersten Mal eine der drei hochgiftigen Schlangenarten Tasmaniens. Die Tiger Snake. Sie wärmt sich auf dem Holzsteg vor mir, noch etwas steif und unweglich von der letzten Nacht. Tiefschwarz glänzt ihre Haut im Sonnenschein. Ihr Anblick lässt mich erstarren. Angst. Ehrfurcht. Und jede Menge Respekt. Einen Meter wird sie schon lang sein und so dick wie mein Handgelenk. Ihr Biss würde mich töten. Sie schlängelt vor mir her, sucht einen neuen Weg und findet ihn nicht. Sie wird vom warmen Holz angezogen wie ein Magnet und weigert sich, ihn zu verlassen. Nach einigem Zögern gleitet sie unter die Bohlen. Es gibt keinen Weg um sie herum. Ich muss quasi über sie hinwegsteigen. Mein Herz hat schon lange nicht mehr so sehr geklopft wie in diesem Augenblick. Und die Luft war noch nie so süß. Wissend, das meine Atemzüge gezählt sein könnten.
Auf dem folgenden Anstieg bleiben alle meine Sinne in Alarmzustand. Noch eine kleiner Schlange sehe ich heute. Aber sie ist schon fast verschwunden, bevor ich sie richtig wahrnehmen kann. Auch sie wäre im Ernstfall ein direktes Todesticket. Bisher bin ich relativ sorglos durch diese Welt gelaufen. Die ständige Präsenz der Blutegel hat mich wesentlich mehr gesorgt, als Schlangen oder gar giftige Spinnen, von denen es auch mehr als genug gibt. Aber jetzt nehme ich Kontakt auf mit diesen Wesen. Ich tauche in meine eigene Angst und will verstehen, woher sie kommt. Warum es so eine kollektive Panik und ein tiefes Unwohlsein bei ihrem Anblick gibt. Warum werden alle schlechten Eigenschaften mit Schlangen und Spinnen assoziiert? Warum gibt es keine Heldengeschichten von diesen Tieren?
Eva und die Schlange poppt in meinen Kopf. Klar, christliche Religion und diese felsenharte Verbindung von der Sünde, die tief ins menschliche Selbstbild gebrannt ist. Mit Feuer und Schwert. Über tausend Jahr. Die Bilder von alles verschlingenden Schlangen tauchen auf. Ich habe sie zu Genüge gesehen. Live in Afrika und auf unzähligen Bildern. Beängstigend. Ekelerregend. Grausam.
In diesem Moment erscheint ein anderes Bild in mir. Schiebt sich darüber. Menschen, die Berge von Fleisch in sich hineinstopfen. Bilder vom Münchner Oktoberfest. Brathändel. Schweinshaxen. Erinnert uns die Schlange einfach nur an uns selbst? An den Teil in uns, mit dem wir uns am liebsten überhaupt nicht auseinander setzen wollen? Ist sie nicht nur ein Spiegel? Gibt es etwas giftigeres, tödlicheres und darüber hinaus noch gierigeres Wesen als uns selbst? Kann irgend ein Tier da mithalten? Nein. In diesen Augenblicken, in denen wir ohne Sinn, Verstand, Herz und Gefühl handeln, können wir im Handumdrehen zu Tötungsmaschinen mutieren. Jede Regung in uns mit Macht unterdrücken und das verkörpern, was wir eigentlich am wenigsten sind. In Verherrlichung einer Idee, aus der Angst heraus, nicht dazuzugehören oder etwas in uns zu fühlen, mit dem wir in diesem Augenblick nicht in der Lage sind klarzukommen.
Je mehr ich darüber nachdenken und in mich hineinlausche, umso näher kommt die Schlange meinem Herzen. Es ist noch lange kein Frieden in mir. Aber ich habe eine Ahnung von ihrer Schönheit. Einen kleinen Funken von der Eleganz ihrer Bewegung. Und den Wunsch, ihr eines Tages wie eine Schwester begegnen zu können. Staunend über das Wunder, das sie verkörpert.
Mein Weg hat Bäche gekreuzt, wundervolle Wasserstellen, herrliche Pausenorte. Ich bin über endlose Steinfelder geklettert und ein Labyrinth von Baumwurzeln. Jeder Schritt dieses Aufstiegs fordert meine ganze Präsenz.
Ich spüre die Müdigkeit in mir. Die vielen aufeinanderfolgenden Wanderungen werden fühlbar. Das Gewicht meines Rucksacks zieht ich nach unten. Der Wunsch nach einem Ende plustert sich auf wie Daunenfedern. Und zu allem Überfluss schwimme ich noch in den Energiefetzen all meiner Vorgänger auf dem Trail. Ich schwimme mittendrin in ihrer Angst, in ihrem Streß und in den inneren Alarmzuständen. Mein Magen gluckst vor sich hin, als würde er gern Durchfall weiter nach unten schicken. Und ich habe Hunger, obwohl das Frühstück nur so kurz zurückliegt.
Als ich auf dem Pelion Gap ankomme, dem höchsten Punkt an diesem Tag, erwartet mich ein Schlag aus Hitze. Die Sonne ist auf ihrem Mittagshoch angekommen und schickt sengendes Feuer auf die ausgetrocknete Erde. Und hier oben gibt es kein schützendes Dach aus Bäumen mehr über mir.
Redeschwall erwartet mich. Und eine lange, lange, lange Reihe von Rucksäcken. Fein sortiert und gut geschützt vor den Currawongs. Schwarzen und ungemein cleveren Vögeln - fast genauso kreativ und intelligent, wie die neuseeländischen Kea's. Sie haben schnell gelernt, wo die Wanderer ihre Müsliriegel verstecken. Reißverschlüsse stellen für sie keinerlei Hürde dar. Und sie lieben es, alles am Rucksack auseinanderzunehmen, wenn es auch nur entfernt nach spannendem Essen duftet oder eine andere Art von Zerstreuung bietet. Mülltüten samt Inhalt zum Beispiel. Einmal sollen sie sogar einen Reisepass gemopst haben.
Rechts von mir thront Mt. Ossa. Aus dieser Perspektive ist er ernüchternd. Da würde mich Pelion East mehr einladen. Ich erkenne nichts wieder. Noch nicht. Erst einmal brauche ich sowieso ein langes, langes Picknick und jede Menge Essen. Ich geniesse den Ausblick. Ich geniesse diesen Platz. Ich geniesse das Gefühl, das ich jetzt erst einmal freie Sicht habe. Die Weite hat mir im Wald gefehlt, trotz des wohltuenden Schattenbonus.
Noch einmal überlege ich. Noch einmal wäge ich in mir das weite Spektrum an Für und Wider die Besteigung ab. Es ist nicht einfach, denn hier sirrt mir die Energie der freudigen Gipfelaufstiegsstürmer gnadenlos und ungefiltert um die Ohren. Verstärkt wird der Strudel durch die vier Leute, die schon oben waren, und mich nun fast kopfschüttelnd wie ein fremdes Insekt begutachten, weil ich tatsächlich erwäge, weiterzulaufen. In ihren Augen bin ich verrückt. Besonders bei diesem Wettergottgeschenk an blauem Himmel und Sonnenschein.
Ich habe noch nie so sehr darum gekämpft, ganz bei mir selbst und meiner Wahrheit zu bleiben. Wie sehr mich das erschöpft, habe ich beim Aufstieg gemerkt. Und mir wird jetzt auch klar, das das nichts mit fehlender Fitness zu tun hat sondern mit dieser Herausforderung alle fremden Energien herauszufiltern und nur mir selbst zu folgen. Ich bin jedes Mal wieder vollkommen überrascht, wie sehr das jeden Teil von mir fordert. Es ist wie ein Marathonlauf. Der gesamte Körper mit all seinen Reserven wird dabei angezapft. Und die Müdigkeit schwappt herein.
Obwohl es jetzt bergab geht, sind meine Schritte nicht wirklich voller Elan. Ich sehne das Ende herbei. Ich wünsche mir mein Zelt und Ruhe. Einfach nur Ruhe. Dummerweise gehe ich an einen Ort, wo ich all die Energie, von der ich mich gerade abwende, wieder um mich haben werde. Dann noch einmal in voller Stärke, denn natürlich wird es heute Abend in der Hütte kein anderes Gesprächsthema als diesen Berg geben. Zelten ist also auf jeden Fall absolutes Muss für mich.
Kia Ora Hut versteckt sich gekonnt. Es dauert Ewigkeiten, anzukommen. Und als ich da bin, warten schon die ersten müden Recken und strecken ihre Füße in die Sonne. Die Hütte ist winzig, besonders im Vergleich zu Letzten. Der ursprüngliche Grundriß wurde nicht wirklich verändert. Alles ist klaustrophobisch eng. Zwanzig Leute wollen hier schlafen? Halleluja! Nichts wie raus!
Mein Zeltplatz ist ein Gedicht. Freier Blick auf den Pelion East. Jetzt hätte ich Lust auf ein Bad. Aber der in allen Publikationen angepriesene Platz entpuppt sich als flacher Bach. Es ist zu trocken, um wirklich viel Wasser dort zu finden. Ich muss ziemlich lange suchen, um mich irgendwie ganz hineintauchen zu können. Ausgestreckt. Liegend. Eng an den Boden geschmiegt. Es ist herrlich eisig, aber bleibt unbefriedigend. Ich würde soooooo gern richtig schwimmen. Ich bräuchte einen rauschenden Wasserfall. Ich bräuchte wirkliches wildes Fließen. Vielleicht gibt es noch andere Plätze am Bach, aber das Gras steht überall hoch und ist uneinsehbar. Und das hier ist definitiv Schlangenland. Ich kann ihre Energie deutlich spüren.
Es ist auch eindeutig Mücken und Fliegenland. Ich bin weit entfernt von der inneren Gelassenheit, die es bräuchte, um sie in Ruhe zu ertragen. Und so bleibt mir nichts weiter übrig, als mitten in der Hütte zu sitzen, heißes Wasser zu schlürfen, den Leuten beim Ankommen zuzuschauen und irgendwann, nach einem langen, langen, langen späten Nachmittag und frühem Abend, verschwinde ich hinter dem Schutz meiner Zeltgaze....