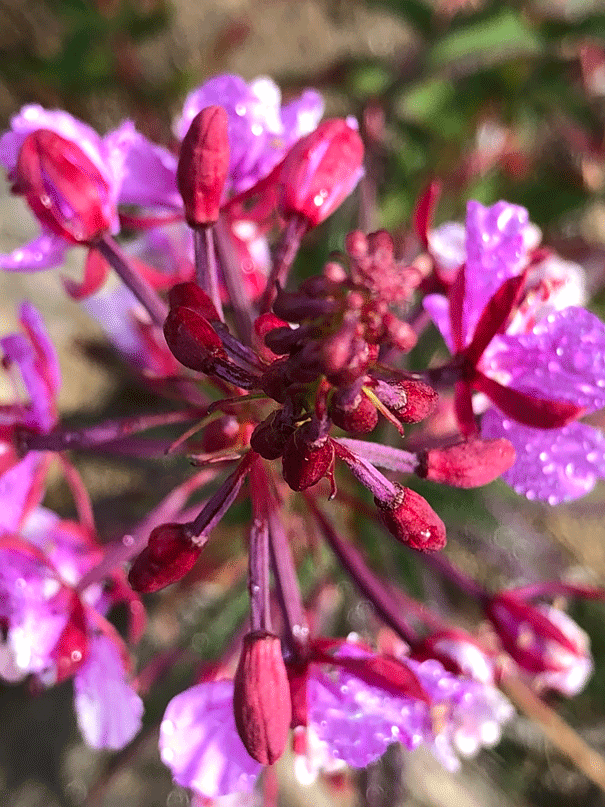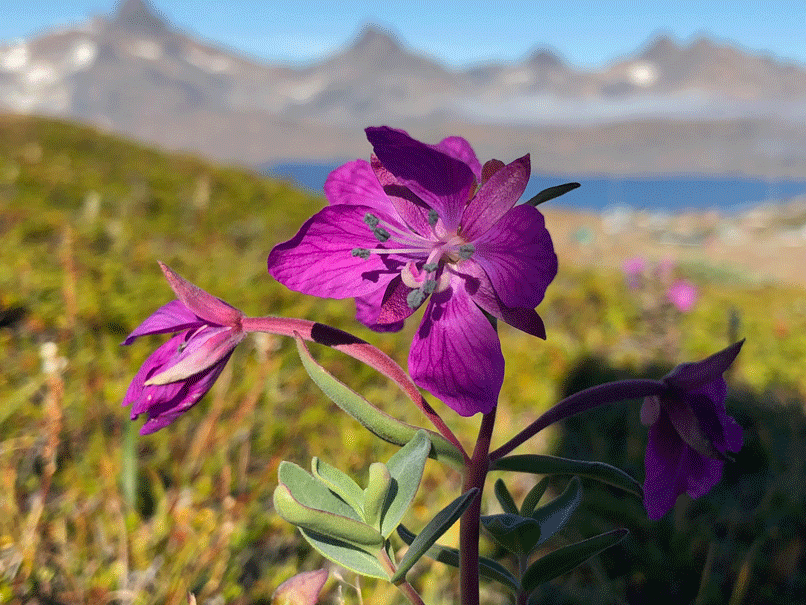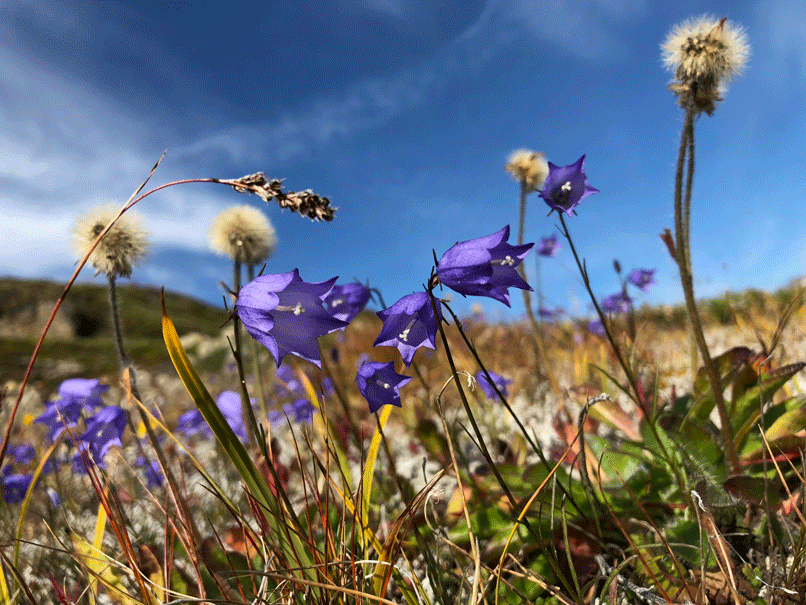Der Hillary Trail

Wie machen das die Kiwis nur? Wie können sie solche Pfade gut finden? Das, was für mich ausgewaschene Geröllhalden oder pure Schlammrutschen sind, finden sie vollkommen normal. Steilküstenpfade in Fußbreite mitten in frischen Abbruchkantengebieten? Warum nicht? Kletterpartien? Kein Problem. Dort läuft man lang oder hangelt sich an der Kette über dem Abgrund. Mit Rucksack. Mit allem drum und dran. 12-15 Kilo auf dem Rücken. Unter sich nichts, das einen auf dem Weg nach unten aufhalten könnte. Gar nichts.
Auf dem Hillary Trail muss die ganze Ausrüstung mit. Zelt, Kocher, Essen, Kleidung. Das gesamte Programm. Es gibt keine Hütten, aber es gibt die Möglichkeit, Privatunterkünfte zu nutzen. Denn es ist keine pure Wildniss. Es gibt Siedlungen auf dem Weg, immer mal wieder. Dort eine alte Lodge, dort ein ganzer Ort.
Dieser Weg wird von Schulklassen begangen. Er steht quasi auf dem Curriculum. Leider, denn so komme ich in den für mich sehr zweifelhaften Genuss der Anwesenheit von 14-Jährigen auf den schönen "stillen" Zeltplätzen. Die Kids gehen nicht den gesamten Weg. Aber ich möchte genau diese ganze Länge gehen. Vom Arataki Visitor Center bis nach Muriwai. 75 Kilometer entlang meiner Traumküste. 75 Kilometer ständiges Auf und Ab. 75 Kilometer voller Herausforderung.
Nachdem ich ein Teilstück dieses Weges mit leichtem Rucksack gelaufen bin, wollte ich die ganze Aktion schon abblasen und als für mich unmachbar abhaken. Aber da ist so eine hartnäckige Stimme in meinem Inneren, die unbedingt jeden Schritt gehen will. Eine Stimme, die an jeden Strand will. Weil das hier für mich das Herz meines Neuseelands ist.
Und so tue ich es doch. So sorgfältig vorbereitet, wie ich es nur kann. Gut zwei Wochen nach diesem ersten Versuch. Allerdings galoppiere ich nicht in 3 oder 4 Tagen durch das Land. Ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit. Und wie sich herausstellt, hätte ich es nicht besser machen können....

Ich wohne ganz in der Nähe des Wanderausgangspunktes. Nur sechs Kilometer leichter, weiter Weg trennen mich vom Besucherzentrum in den Waitakere Ranges. Die gehe ich leichten Herzens. Auch wenn der Rucksack ziemlich auf den Schultern drückt und die Beine noch etwas wacklig laufen, von der ungewohnten Last. Aber - die Aussichten sind fantastisch, die nebenan verlaufenden Straßenklänge lassen sich leicht weg-beamen und in mir wächst Zuversicht, das ich das ganze Unternehmen schaffen könnte.
Arataki ist mein Frühstücks-Stop. Ich war vorher viel zusehr auf Loslaufen fokussiert um auch nur ein Zipfelchen Hunger zu verspüren. Hier, am offiziellen Start der Wanderung sitze ich nun vergnügt im Schatten, labe mich an Müsliriegeln und freue mich auf die nächsten Schritte.

Ganz früh am Morgen, die Kids schlafen fast noch, breche ich auf. Diese Morgenkühle ist mein liebster Wegbegleiter. Ich bin ein Frühaufsteher und ich genieße es, die Welt um mich herum beim Erwachen zu erleben. Am Anfang ist strahlender Sonnenschein mein Begleiter. Und ein Weg, der zunehmend herausfordernder wird. Aus gut ausgebaut (für die Tagestouristen, die mit dem Auto einen kurze Strecke laufen wollen) wird ein schmaler, schlamm- und matschüberzogener Kletterparcours. So steil, das ich oft genug alle Viere brauche, um vorwärtszukommen. Dazwischen warten kleine Bäche mit den geliebten Steinkletterpartien vorbei an schnell gurgelndem Wasser.

Ich hätte mir kein größeres Geschenk machen können, als so einen Ruhetag. Einen Tag, um mich wirklich mit der Welt um mich herum zu verbinden, ohne Rucksack auf dem Rücken. Einfach nur mit mir und der Natur. Zeit zum Entdecken von Orten, die man sonst niemals finden würde. Zeit zum Fühlen.
Der Vormittag gehört dem Whatipu River, der sich durch traumhaft schöne Wiesenlandschaften schlängelt, überschattet von Bäumen, die malerische Tupfer in der grünen Weite erschaffen. Vorbei an herrlichsten Schwimmstellen. Bis dorthin, wohin mich der Leiter der Lodge gelotst hat. Ein Platz wir aus dem Paradies. Eiskaltes Wasser, ein sonnenbeschienener Felsen, ein leichter Einstieg. Nackt sitze ich hier, stundenlang, lausche den Vögeln, tauche in eine unendliche Stille ein und freue mich an den Farnwedeln über meinem Kopf.

Es ist eine kurze Strecke heute. Ich habe keine Zahlen, aber sonniges Wetter hat mich auf grandiosen Ausblicken begleitet. Die ganze Zeit. Meine Verbindung mit dem Land ist tief geworden in diesem einen Tag der Stille und des Fühlens. Sie wird mich nicht mehr verlassen. Meine Schritte sind ruhiger geworden, gemächlicher. Dieses innere "mich-beweisen-wollen" wird langsam ruhiger. Es macht Platz für den weiten Raum in meinem Herzen, der jeden Moment mit Freude umarmt.
Sogar bei diesem Abstieg ins Pararaha Valley. Immer am Abgrund. Rutschig und teilweise wirklich gefährlich. Ein falscher Schritt und ich würde knapp hundert Meter tiefer im Tal liegen. Besonders eine Stelle vertreibt mir fast die Zuversicht. Purer, blanker, rutschiger Stein. Kaum Tritte. Eine Kette zum Halten. Sonst nichts.

Die Wanderer des letzten Abends sind früh aufgebrochen. Ich bleibe allein auf dem Platz zurück und fühle mich irgendwie falsch. Als gäbe es nur eine Art, unterwegs zu sein. Voll im Leistungsdenken. Schnell. Effizient. Sie laufen in vier Tagen die gesamte Strecke. Ich ertappe mich beim Vergleichen, als gäbe es dort eine Meßlatte. Und noch etwas macht mir zu schaffen. Es gibt eine Diskrepanz zwischen meinem Fühlen und der Wirklichkeit.
Die Natur - die Landschaft, alles ist richtig, alles ist so, wie es sein sollte. Aber diese Schwierigkeit des Weges, die Mühsal des Rucksack-Schleppens, die Schikanen des Kletterns - sie passen nicht zu meinem Gefühl. Sie verhaken sich in meinem Inneren und machen mich wütend und traurig. Etwas stimmt hier nicht.

Ich bin so fokussiert, diese lange Strecke heute gut zu schaffen, das die Traurigkeit darüber, Karekare zu verlassen erst viel später in mein Bewußtsein fließt. Doch heute ist ein Wendepunkt. Ich verlasse die Wildniss. Ich verlasse mein Paradies. Schon am Parkplatz in Karekare erlebe ich die Welt wieder mit voller Wucht. Auch wenn es noch früh am Morgen ist, tummeln sich hier schon die Autos. Später am Tag wird alles überfüllt sein. Jeder möchte hierher. Nur so weit weg vom Parkplatz, an meinem Ort, habe ich kaum etwas davon gemerkt.
Mein Weg führt mich an einer der absolut schönsten Küste Neuseelands entlang. Die höchsten Klippen sind ein willkommender Rastpunkt, bevor ich ein Stück Straße gehen muss. Überall begegnen mir Menschen. Die Stille der letzten Tage ist vorbei. Auf den letzten Metern des Tages komme ich an einem Wasserfall vorbei. Überall sonst, wäre ich geblieben. Lange. Ich wäre geschwommen und hätte mich mit dem fließenden Nass verbunden. Aber hier ist Sonntag.

Süßes Nichtstun. Und gleichzeitig Abschiednehmen. Es ist genau der Übergang, den ich brauche nach Karekare. Ein wenig Strandspazieren, ein wenig Sonnenuntergang, ein wenig Fotografieren, ein wenig Lesen, ein langer Mittagsschlaf und viel gutes Essen.
Aber die tiefen Gefühle der letzten Tage erreichen mich hier nicht. Piha ist der angesagteste Strandort der Auckländer. Hier ist Party- und Surfstimmung. Keine Stille. Aber es macht nichts. Es ist trotzdem der richtige Ort für mich....

Nur ca. zwei Stunden geht es heute bergauf. Dann bin ich auf meinen letzten Campingplatz. Allein. Endlich einmal ganz allein. Zum ersten Mal auf dieser ganzen Wanderung kann ich die Stille wieder hören. Piha ist nur einen Bergrücken weit weg, aber ich bin in einer anderen Welt. Den ganzen Tag habe ich Zeit, die Umgebung zu erkunden, Strand für Strand zu erleben und mich wieder in den Rhythmus von Meer und Wind einzufühlen. Es wird windig werden hier oben, heute Nacht. Der Platz ist völllig exponiert. Ich kann nicht wirklich viel schlafen. In mir ist Lampenfieber vor dem morgigen Tag und es ist sehr, sehr kalt. Ja, morgen kommt der "große" Tag. Die letzte, lange Etappe.

Das ist er. Der letzte Tag. Die große Herausforderung. Es gibt keine Möglichkeit, diese lange Strecke zu teilen. Kein Campingplatz liegt mehr auf dem Weg und zu allem Überfluß auch keine verlässliche Wasserquelle. Das heißt nicht nur elf Stunden laufen sondern elf Stunden laufen in Sonnenhitze mit all dem Wasser für den gesamten Tag auf dem Rücken. Ich plane ungefähr fünfeinhalb Liter ein. Und es stellt sich heraus, das es perfekt kalkuliert ist.
Aber die ersten Meter mit diesem extra schwerem Rucksack, in dem das Wasser schwappt sind verrückt. Dreieinhalb Kilo mehr sind eine ganze Welt. Ich verteile das Gewicht anders, dann geht es. Der Weg allerdings wird damit nicht wirklich leichter.