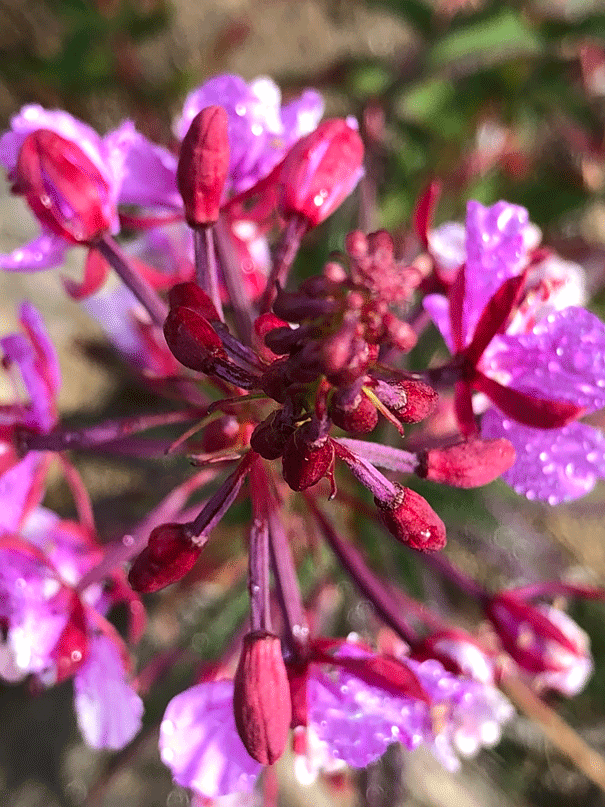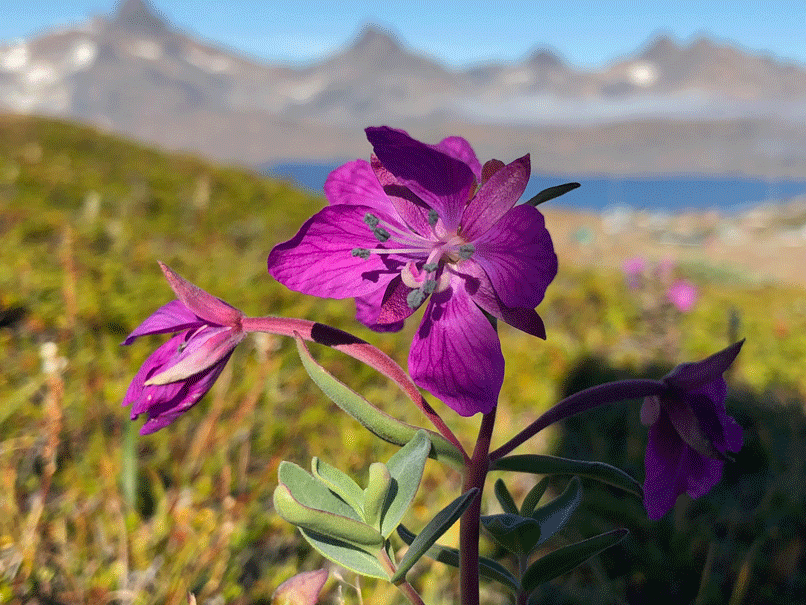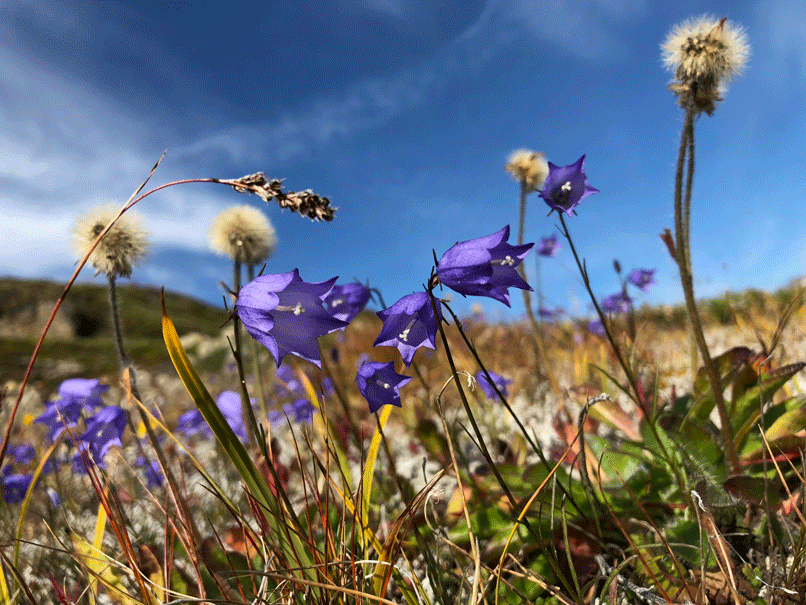Tag 1 - Ronny Creek zum Waterfall Valley
Wanderzeit 3-6 Stunden
10 Kilometer
750 Meter Anstieg, 620 Meter Abstieg








Der Bus von Devonport taucht unmittelbar hinter der Ortsgrenze in eine Welt der Trockenheit. Eukalyptusbäume soweit mein Auge reicht. Gelbe Wiesen. Ausgedörrter Boden. Ich bin geschockt und betrachte dieses Land mit staunendem Blick. Nichts erinnert mich an das Tasmanien in meinem Kopf. Alles fühlt sich fremd an. Vollkommen fremd. Mein Gefühl fährt Achterbahn und versucht mit aller Macht, zwei diametral entgegengesetzte Bilder in eines zu stopfen. Es gelingt mir nicht.
Die Betäubung bleibt. Eine Art von Starre, die mich fast automatisch funktionieren lässt. Eine Art Schutzmantel vor der Unverdaubarkeit der Realität. Einem mit Menschen vollgepacktem Besucherzentrum beispielsweise. Langen Schlangen. Lautem Redeschwall und nervösen Wanderern, die alle versuchen müssen, in nur knapp zwei Stunden ihre Papiere (Nationalparkausweise, Overland-Track Pass und Karte), die noch fehlenden Ausrüstungsteile, lebenswichtige Informationen und den kostenlosen Shuttlebus zum Wanderstart zu bekommen.
Der Bus hat uns kurz nach 11 Uhr hierher gebracht. Ein später Start für eine lange Strecke. Eigentlich viel zu spät. Und so ist die Nervosität nicht nur spürbar sondern bricht auch in Wortgefechte aus. Wie ein Vulkan unter Hochdruck. Jede Frage zuviel am Counter lässt die Leute in der Schlange aus der Haut fahren oder mindestens genervt die Augen verdrehen, samt der passenden knarzigen Bemerkung. Dazu kommt, das der Shuttle die endlose Zahl der Tagesbesucher gnadenlos bevorzugt. Nur zwei Wanderer dürfen je Shuttle mitkommen. Und der Shuttle fährt nur alle fünfzehn Minuten.
Ich fühle mich, wie am Beginn eines Rennstarts, in dem sich jeder mit der Kraft aller Ellenbogen den besten Platz sichern will. Aber ich spiele nicht mit. Ich habe den späten Anfang schon vor Wochen akzeptiert. Bei der Vorbereitung. Bei der Organisation. Und ich habe Zeit. Es ist mir egal, ob ich erst kurz vor der Dunkelheit ankomme oder schon am Nachmittag. Ich brauche auch keinen einzigen der beiden Berggipfel auf dem Weg zu besteigen, weil ich sowieso länger im Waterfall Valley bleiben will und die Besteigungen einfach später machen kann.
Und so laufe ich gemütlich vom Bus hinüber zum Eingang und finde mich entspannt an zweiter Stelle wieder. Keine Ahnung, wo alle anderen waren. Und als ich dann zum Shuttle komme, wartet schon ein Bus auf mich, der noch einen Platz hat. Eine Mitwanderin, die aber hier übernachtet und es absolut nicht eilig hat, lässt mir den Vortritt. Und plötzlich bin ich, ganz in Ruhe, die Erste, die auf dem Weg ist.
Im Shuttle-Bus bin ich schon wieder in einer befremdlichen Theaterkulisse gelandet. Um mich herum, Menschen, die nur ein Wenig an der Natur schnuppern wollen. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Kein Wanderer. Niemand, der die Fitness austrahlt, die es dafür brauchen würde. Es sind ältere Leute, manchmal sogar mit Stöcken, die hier sitzen und geruhsam hinter der Glasscheibe Wildnis fühlen wollen. Aber bitte nur ein klitzekleines Stückchen. Der Fahrer fungiert gleichzeitig als ihr Guide und erklärt jedes Detail.
......
Eines seiner Statements lässt mich aufschrecken. Die Essenz lautet: "Wo immer der Mensch hinkommt, zerstört er die Natur." Dieser Nationalparkführer vertritt die Meinung, das die Natur vor uns geschützt werden muss. Das wir eigentlich gar keinen Schritt hier hereinsetzen dürften, weil wir damit schon ein Juwel zerstören. Hier leben Pflanzen, bei der schon der PH-Wert unserer Haut ein Problem darstellt. Für ihn steht die Natur ganz oben und wir sind nur Trampeltiere im Paradies. Unfähig, uns achtsam zu bewegen. Unfähig, nichts in kleinste Stücke zu schlagen und eigentlich sollten wir besser verschwinden. Er spricht mit einer solchen Überzeugung, das er sich eigentlich besser gleich selbst in Luft auflösen sollte. Mich erreicht eine ganze Welle von so tiefer Menschenverachtung (und damit auch Verachtung seines eigenen Wesens) und ungefilterter Naturverherrlichung, das mir schlecht wird.
Ich kann spüre, woher diese Ansicht kommt, ich kann sie auch nachvollziehen. Ich bin nicht blind. Ich sehe jeden Tag, wie Menschen mit der Natur umgehen. Ich fühle ihre Unbewußtheit und die Gedankenlosigkeit. Sie tut mir weh und ja, sie zerstört. Aber das ist nur die eine Seite der Wirklichkeit. In den Augen dieses Mannes sind wir bloße Viren und Zerstörungsmaschinen in einem Paradies. Das ist so radikal und so zweidimensional, das die Gänsehaut bleibt. Auch nach dem Aussteigen aus dem Bus. Umso mehr, weil er damit den Glauben der Menschheit von sich selbst in Worte fasst. Das ist die Überzeugung der Menschheit von ihrem eigenen Wesen. Das ist die Quintessenz. Das ist auch einer der Gründe, warum unsere Welt so aussieht, wie sie aussieht. Denn diese Überzeugung muss und will sich immer wieder bestätigt sehen.
In diesem Augenblick wird mir die Wichtigkeit meiner Arbeit so klar, wie ein sternenübesäter Nachthimmel. Meine Überzeugung ist das pure Gegenteil. Jedes Wort, das ich schreibe, jeder meiner Gedanken und jedes Gefühl sieht die Schönheit, die Vollkommenheit und das Strahlen der menschlichen Seele. Das Funkeln hinter Mauern und tiefen, schweren, schwarzen Schleiern. Das weite Herz hinter den blutenden Wunden. Und den Weg ins Licht, für die Erde und für die Menschen. Ich sehe weiter. Ich schaue auf den Horizont und nicht nur auf die fünf Zentimeter vor meinen Augen. Dieser Blickwinkel verändert alles. Es lässt die Liebe in mir duften, wie ein sommerlichtdurchtränkter Blütenteppich. Und er lässt mich lächeln, entspannt, glücklich und im Frieden mit meinem Sein und dem Sein dieser Welt.
.......
In diesem Gefühl gehe ich die ersten Schritte. Über einen weiten, langen Holzbohlenweg. Über ein fragiles Moor, gesprenkelt mit dem Wunder der Pflanzenvielfalt. Sechshundert endemische Arten gibt es allein in diesem Nationalpark. Dieses riesige Gebiet von 1, 5 Millionen Hektar (1/5 der Gesamtfläche Tasmaniens) sind UNESCO-Weltkulturerbe und es ist eine Schatzkammer. Gut gesichert und nur an den Eckpunkten zugänglich. Bis auf diesen Trail, auf dem ich gerade gehe. Er führt mich mitten hindurch. Von Norden nach Süden.
Und im Augenblick geht es steil bergan. Hinauf zum Crater Lake und weiter zum Marions Lookout. Das ist der Anstieg meiner Erinnerung. Kein Wandern. Klettern. Himmelsleiter-Gefühl. Diesmal bleibt mein Körperschwerpunkt dort, wo er hingehört. Mit einem Gefühl des Triumphs stehe ich aum höchsten Punkt. Aber nicht lange. Das hier ist die Welt der Tageswanderer. Mein Blick schweift über das karge Land, in das deutlich sichtbare Schneisen geschlagen sind. Wege. Ein ganzes Netz davon überzieht diese Gegend. Die Besuchermassen sind hier so greifbar, das es mich schaudert. Ich bin auf Wildnis eingestellt. Einsamkeit. Diesen weiten Himmel und unberührtes Land. Ich bin auf die Bilder in meiner Erinnerung eingstellt. Sie sind einer der Gründe, warum ich wieder hier bin. Um mich herum, herrscht das Gegenteil. Schnaufende Wanderer mit leichten Rucksäckchen klettern auf das Plateau und gratulieren sich gegenseitig zum Gifpelsturm. Im Tal ist der Shuttle-Endpunkt zu sehen. Die Gebäude, die öffentlichen Toiletten, parkende Autos.
Zeit abzutauchen. Ich kehre der Welt den Rücken zu. In der anderen Richtung herrscht wohltuende Leere. Selbst am Abzweig zum Cradle-Mountain, einem der beiden Gipfelmöglichkeiten des Tages, fühle ich mich nicht mehr überrollt. Ich weiß, das ich spätestens ab hier ziemlich allein sein werde. Endlich!
Der Weg ist anstrengend. Die Sonne heizt die Erde zu einem Backofen auf. Es geht über Stock und Stein. Unkonzentrierte Schritte sind ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder Zentimeter will bedacht sein. Ich spüre wie mein Enthusiasmus langsam schmilzt. Der Weg wird länger. Barn Bluff, mein Lieblingsberg in diesem Park, lacht mich schon lange an, aber der Weg um ihn herum, hinunter zum Waterfall-Valley nimmt kein Ende.
Endlich. Endlich bin ich da. Erleichtert, erschöpft, müde. Hier sieht alles noch so aus, wie in mir. Nur, der wundervolle alte Ranger ist nicht mehr da. Die Hütte ist leer. Niemand hat sich für diese Schlafmöglichkeit entschieden. Alle sind hinunter zum Zeltplatz geströmt. Und auch mich zieht es dorthin. Auch wenn das ständiges Laufen zwischen der weit entfernten Toilette, der Wasserquelle und meinem "Häuschen" bedeutet. Ich will draußen bleiben. Weil es jetzt langsam angenehm frisch wird. Pure Erleichterung nach der Sonnenglut des Tages.
Außerdem will ich mein neues Zelt ausprobieren. Und ganz, ganz nah an der sternklaren Nacht und der Kälte der Dunkelheit sein....
Der Trubel um mich herum fließt durch mich hindurch wie klares Wasser. Nichts davon betrifft mich. Ich bin damit beschäftigt, anzukommen. Wirklich anzukommen. Denn immer noch ist alles störrisch fremd und neu. Und so sinke ich früh in den Schlaf. Hinein in Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Eisige Luft. Es braucht alle meine Kleiderschichten, um warm zu bleiben. Aber ich schlafe tief und fest und träume von Känguruhs, Moosen und diesen markanten Berggipfeln aus Doloritsäulen.