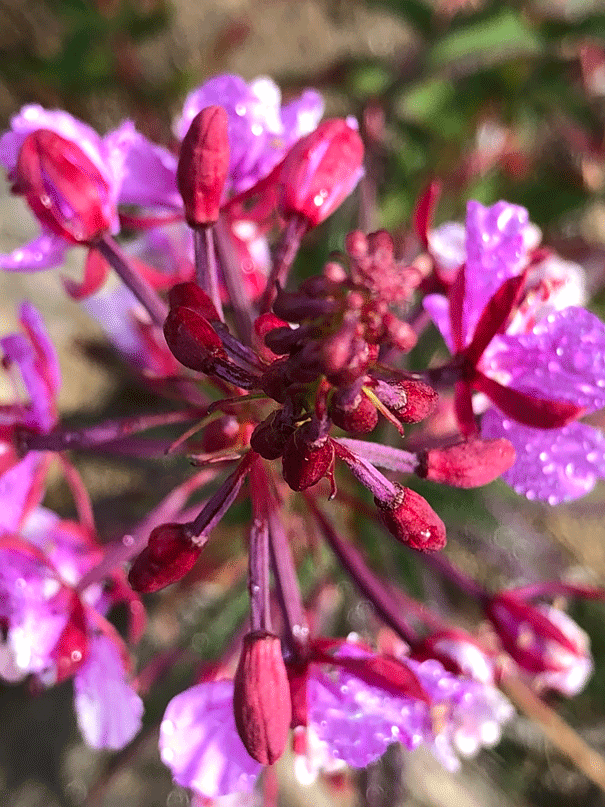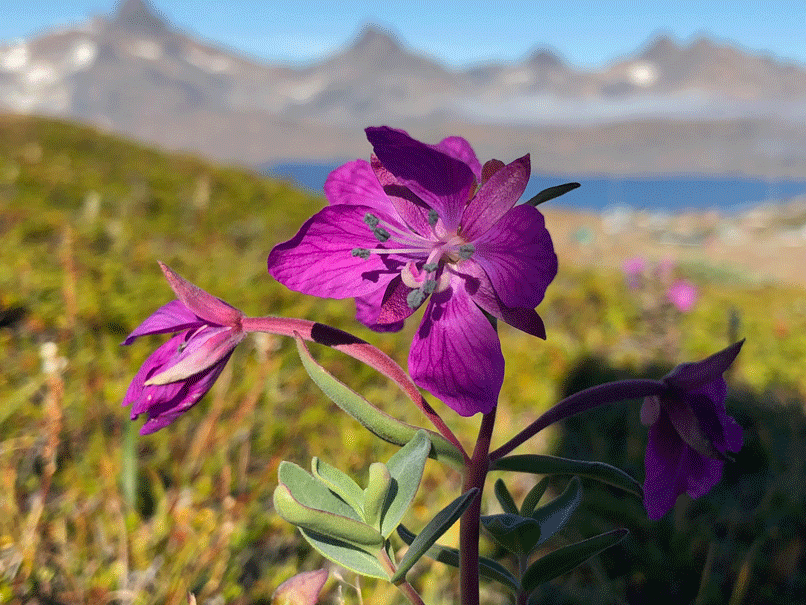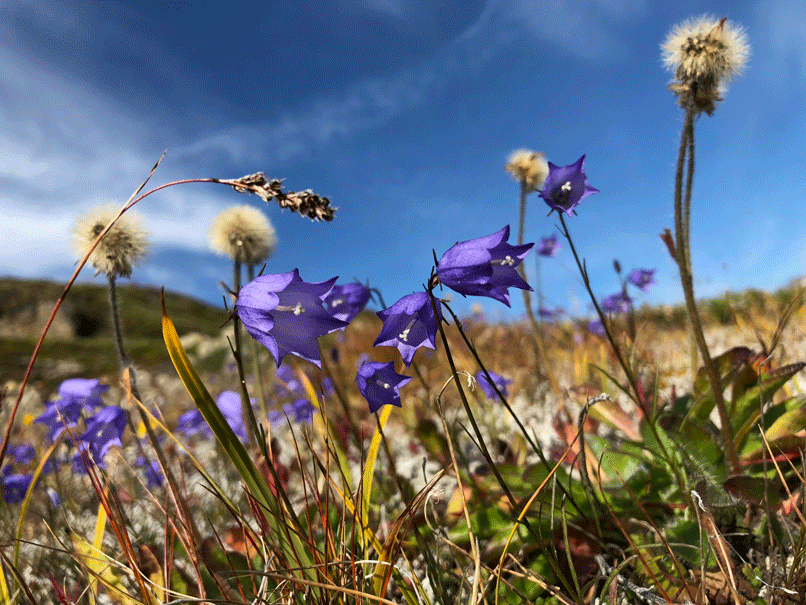Der Abel Tasman National Park auf der neuseeländischen der Südinsel ist eine Perle. Traumstrände, fantastische Felsformationen und Wasser wie aus dem Bilderbuch. Doch leider ist er zu einer Perle geworden, die jeder kennt und unbedingt in seiner Schmucksammlung haben möchte. Dank der Lage des Park's direkt am Wasser, ist der Zugang so leicht, ist wie nirgendwo sonst. Der Weg zu Fuß ist die mühevollste Variante. Viel schneller und vor allem einfacher geht es mit einem Boot. Und so strömen Tag für Tag wahre Besuchermassen als Tagestouristen in eine Region, die ich vor dreizehn Jahren als Paradies im Gedächtnis gespeichert hatte. Viel ist davon nicht mehr übrig. Die Stille und Schönheit wird vom Dröhnen von Wassertaxis und dem nicht enden wollenden Gesprächen der Menschen übertönt.
Spätestens morgens um neun legen die ersten Motorboote auf den (gerade mal und gerade noch) stillen Campingplätzen an. Mit ihnen beginnt der Ansturm der Tagestouristen auf den goldgelben Sand des Paradieses. Jetzt werden auch die Kajaker wach und machen ihre Boote fertig. In den Hütten am Weg geht der Tag noch viel früher los. Gegen sieben. Der Lärmpegel und die Geschäftigkeit bleiben. Den ganzen Tag. Bis die Sonne wieder untergeht.
Der Weg selbst ist eine Autobahn geworden. Das er einer der berühmten Great Walks ist, hilft hier nicht viel. Das Quotensystem, das die Zahl der Wanderer reglementiert, gilt nicht für die Tagestouristen und Kajakfahrer. Noch dazu ist jetzt Hochsaison. Und ich bin mittendrin.
Ich habe gezögert. Doch am Ende siegt mein Wunsch, diesen Ort noch einmal zu erleben. Beim letzten Mal war ich hier praktisch allein. Es war tiefer Winter. Ich kann mich an diese herrlichen Campingplätze an einsamen Stränden erinnern. An endlose Sonnenaufgänge, erfrischende Bäder im klaren Ozean und Stille. Soviel Stille. Damals bin ich nicht die gesamte Strecke gelaufen. Das möchte ich jetzt nachholen. Einundfünfzig hervorragend ausgebaute Kilometer liegen vor mir. Von Marahau bis Wainui. Die Orte meiner Erinnerung existieren noch. Alles andere stammt aus einem anderen Universum. Und es fällt mir unendlich schwer, mit dieser neuen Realität irgendwie meinen Frieden zu machen.
Tag 1 - Marahau nach Te Pukatea

Ich breche von Nelson auf, an diesem frühen Morgen. Von dort bringt mich der Transferbus direkt zum Ausgangspunkt der Wanderung. Mit mir zusammen beginnt eine ganze Schar Jugendlicher den Trail. Es ist keine große Gruppe, es sind viele kleine. Sie feiern den Beginn ihrer Wanderung mit Wunderkerzen und Sekt. Nebenan lockt ein Café zum letzten leckeren Süßstoff-Versorgungs-Stop. Aber ich möchte nur weg. Es ist mir zu voll, es sind mir zuviele Menschen. Schon die Busfahrt war eigentlich zuviel. Ich möchte eigentlich nur Stille und laufen.

Die Sonne ist gerade aufgegangen und kitzelt mich mit ihren ersten Strahlen wach. Es ist ein grandioser Morgen. Das Meer - spiegelblank. Das warme Licht lockt mich ins Wasser. Nackt springe ich in die Kälte und bin zum ersten Mal versöhnt mit dieser Welt. Es ist so schön an diesem Ort. So unendlich schön. Auch jetzt bin ich nicht allein hier, auch Andere sind schon wach. Aber ich bleibe einfach ganz bei mir. Es kümmert mich nicht, nackt gesehen zu werden. Im Gegenteil. Ich bin in meiner Welt. Und ich genieße das langsame Trocknen des Salzwassers auf meinen Hautporen.
Es ist ein Trotzgefühl. Wenn all' die Anderen laut sein können, dann kann ich auch nackt sein. Wenn ich die Menschen akzeptieren muss, wie sie sind, dann möchte ich auch so akzeptiert werden, wie ich bin. Ich nehme mir meinen Raum. Aber es ist nicht die Leichtigkeit des Selbstverständlichen, die mich treibt. Er ist vermischt mit dem Kampf um meine Ich-Sein. Und dieser Kampf wird mich den ganzen Tag begleiten.
Halb sechs, nur drei Stunden später werde ich wieder geweckt. Zwei Camper müssen früh los. Sie wollen über ein Inlet, das sich nur bei Ebbe begehen lässt. Und die ist heute entweder früh morgens oder am Abend. Gelassen schlafe ich kurz darauf wieder ein. Bis auch alle Anderen wach werden und den grauen Regentag begrüssen.
Mießpetrig schauen die meisten in den Himmel. Sie haben Sonne gebucht und das hier steht eindeutig nicht auf der schriftlichen Bestätigung. Mir ist mittlerweile klar, das die Tage des Campings vorbei sind. Ich brauche eine Hütte, um in der nächsten Nacht schlafen zu können. Und da es äußerst fraglich ist, ob es in Arawoa überhaupt noch einen Platz dort gibt, muss ich möglichst jetzt loslaufen und mit dem Ranger sprechen.

Ich spüre, wie sehr ich mir selbst im Weg stehe. Ich lebe die pure Rücksichtnahme auf Andere und bekomme das blanke Gegenteil um die Ohren gehauen. Bei jedem Geräusch, das ich selbst mache, zucke ich zusammen. Als würde ich mich am liebsten unsichtbar machen. Wie ein Gegenentwurf zu dem, was ich gestern erlebt habe. Ich spüre, das ich die Balance wiederherzustellen versuche. Aber es gelingt mir nicht. Und ich übernehme damit eine Verantwortung für das Ganze, die ich gar nicht habe. Oder haben sollte.
Es wird den ganzen Weg und noch einen Teil des nächsten Trails brauchen, um das zu begreifen.
An diesem frühen Morgen jedoch versuche ich noch leise tappend meinen Rucksack zu packen. Ich bin die Erste, die in der Dämmerkühle das Inlet durchquert. Wie immer kann ich den Morgen unendlich geniessen.

Ich gehe früh, ich gehe allein, ich gehe in Stille und unendlich langsam. Mein Bus wird mich erst gegen 11:30 Uhr abholen. Aber ich möchte mich ganz bewußt, mit jedem Schritt von diesem Park verabschieden. Mein Blick liebkost jeden Baum, er entdeckt die Vögel, die meinen Weg säumen und die kleinen Küken, die von ihren Müttern eifrig und ängstlich bewacht werden. Am Ende des Anstiegs wartet eine Bank auf mich. Der Blick geht weit über die Golden Bay hinüber bis zum Farewell Spit.