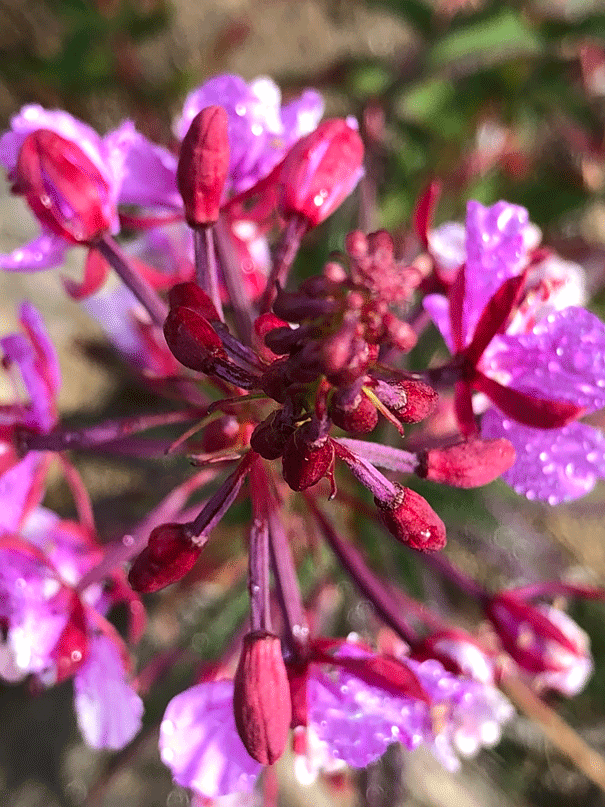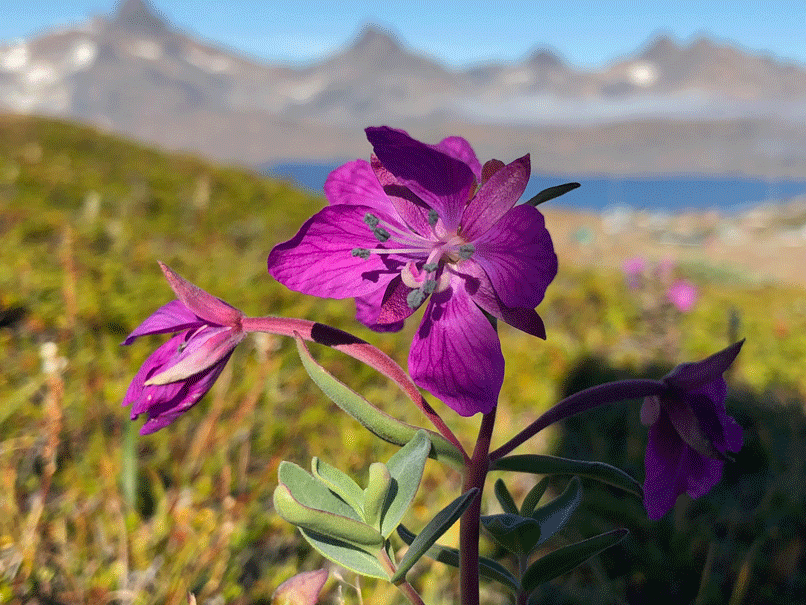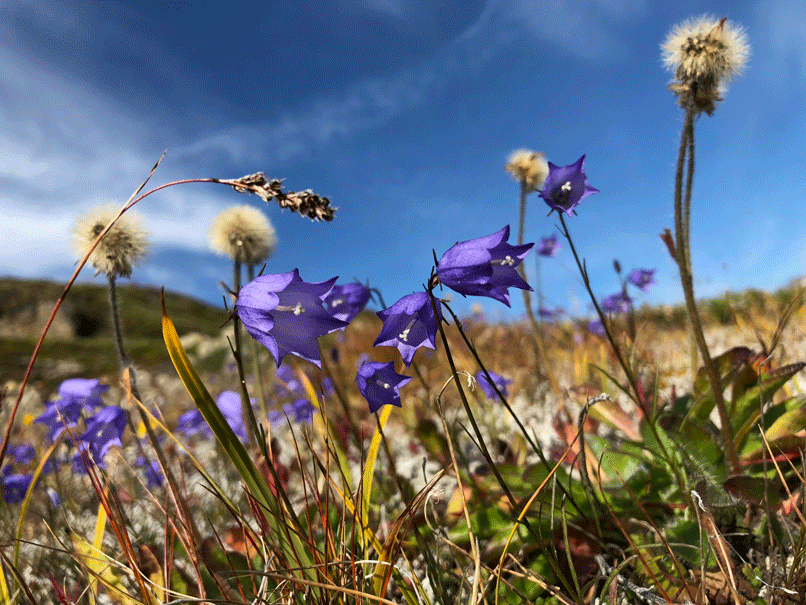Te Pukatea zum Onetahuti Camp Ground
ca. 6-7 Stunden Gehzeit




Die Sonne ist gerade aufgegangen und kitzelt mich mit ihren ersten Strahlen wach. Es ist ein grandioser Morgen. Das Meer - spiegelblank. Das warme Licht lockt mich ins Wasser. Nackt springe ich in die Kälte und bin zum ersten Mal versöhnt mit dieser Welt. Es ist so schön an diesem Ort. So unendlich schön. Auch jetzt bin ich nicht allein hier, auch Andere sind schon wach. Aber ich bleibe einfach ganz bei mir. Es kümmert mich nicht, nackt gesehen zu werden. Im Gegenteil. Ich bin in meiner Welt. Und ich genieße das langsame Trocknen des Salzwassers auf meinen Hautporen.
Es ist ein Trotzgefühl. Wenn all' die Anderen laut sein können, dann kann ich auch nackt sein. Wenn ich die Menschen akzeptieren muss, wie sie sind, dann möchte ich auch so akzeptiert werden, wie ich bin. Ich nehme mir meinen Raum. Aber es ist nicht die Leichtigkeit des Selbstverständlichen, die mich treibt. Er ist vermischt mit dem Kampf um meine Ich-Sein. Und dieser Kampf wird mich den ganzen Tag begleiten.
Doch am Anfang kann ich fast endlos geniessen. Der Weg ist so schön an diesem Morgen. Vorbei an meinen geliebten Farnbäumen, vorbei an wild wucherndem Dschungel, vorbei an köstlich einladenden Wasserlöchern am Fluß. Ich kann jedes Detail auf dem Grund sehen und wäre der Weg heute nicht so lang, würde ich mit Freuden hier den ganzen Tag verplanschen.
Bis Torrent Bay bleibe ich in meiner Balance. Doch ab dort sind alle Menschen um mich herum aufgewacht. Und der Weg füllt sich mit den Tagesgästen. Es vergeht kaum eine Minuten, in der mir nicht jemand entgegenkommt. Oder von hinten aufrückt. Die Energie, die mir dabei um die Ohren schwirrt ist pure Entdeckungssucht. Schnell, viel erleben. Niemand hier hat Zeit. Niemand kann sich Zeit nehmen. Alle laufen nach einem Terminkalender. Ihr Boot wird sie wieder abholen. Punkt soundsoviel Uhr. Die Momente im Paradies müssen gut geplant und durchdacht sein. Jedes Foto ist wichtig als Beweis. Und so drängt diese Masse an Menschen mitten durch die Natur. Lachend, redend, gestikulierend. Wie kann man da irgendetwas von seiner Umgebung wirklich wahrnehmen?
Je mehr Menschen ich begegne, umso mehr wächst meine Wut. Eine unterschwellige Agressivität macht sich in mir breit. Gemischt mit Verzweiflung und Ohnmacht. Dazu kommt, das die Anstiege heute nicht von schlechten Eltern sind. Der Trail fordert mich, auch körperlich. Das zusammen mit dem emotionalen Auslaugen bringt mich an den Rand meines Könnnens. Als ich dann an meinem zweiten Lieblingsstrand, Medlands Beach, vorbeikomme und ihn von einer juchzend schreienden Schülerschar besetzt finde, bin ich am fassungslosen Weinen.
Ich laufe am Bark Bay vorbei. Hier wohnt heute Nacht diese große Gruppe Kids, der ich schon in Anchorage begegnet bin. Sie haben den Strand vollkommen eingenommen. Ihre Energie überschwemmt jedes andere Gefühl.
Der letzte lange und steile Anstieg hinüber zum Tonga Quarry und Onetahuti Beach gibt mir den Rest. Ich bin fast am Ende. Dort unten warten wieder Menschen. Dazu eine lange Reihe Kajaks. Der ganze Campingplatz ist voller Tagestouristen. Onetahuti, so lerne ich jetzt, ist einer der wichtigsten Anlandeplätze der Küste. Gegen vier Uhr werden alle verschwunden sein, die nicht übernachten wollen. Aber bis dahin brauche ich all' meinen Willen, um nicht schreiend auf diese Wesen loszurennen und sie mit allen Waffen, die ich besitze zur Hölle zu schicken.
Nur zwei Amerikanerinnen bekommen einen klitzkleinen Teil meines Frustes ab. Aber auch das ist noch halbwegs kontrolliert. Ich vergesse nicht ganz, wer ich bin. Es ist mir allerdings niemals schwerer gefallen, als hier und jetzt.
Der Abend und dieser kleine Wasserfall, den niemand sonst findet, rettet mich. Dort, in der Stille der Dämmerung, umgeben von Mücken finde ich endlich, endlich den Raum, die Tränen und den ganzen Schmerz aus mir herausfließen zu lassen. Dort kann all die Energie, die ich den ganzen Tag über aufgefangen habe, mein Sein verlassen. Es dauert Ewigkeiten. Ich weine über die verlorende Schönheit, ich weine um das, was nicht mehr ist. Ich weine für mich, um mich und um diesen Ort. Ich weine mit den Bäumen und mit der Erde. Mit den Tieren und mit dem Wasser. Und ich wünsche mir sehnlichst Menschen, die anders sind. Bewußt, fühlend, lauschend. Menschen, die Verbindung wollen, echte Verbindung. Menschen, die Stille aushalten können. Menschen, die sich selbst aushalten können, ohne darüber wegreden zu müssen. Am Ende ist Frieden in mir, für einige Stunden.
Der Wetterbericht hat für heute Nacht Regen angesagt. Schlechte Aussichten. Ganz schlechte. Denn mein Zelt hat sich als alles andere als wassdicht herausgestellt. Ich hoffe auf das Unmögliche. Es geschieht nicht. Mitten in der Nacht beginnt das Wasser zu kommen. Leise, sacht. Aber das reicht schon aus. Ich muss umziehen in diesen kleinen, überdachten Küchenbereich. Dort breite ich meine Habseligkeiten aus, im Dunkeln und finde einen Platz zum Schlafen. Die Sandflies stören mich überhaupt nicht. Ich bin viel zu müde und erschöpft für solche Kleinigkeiten.